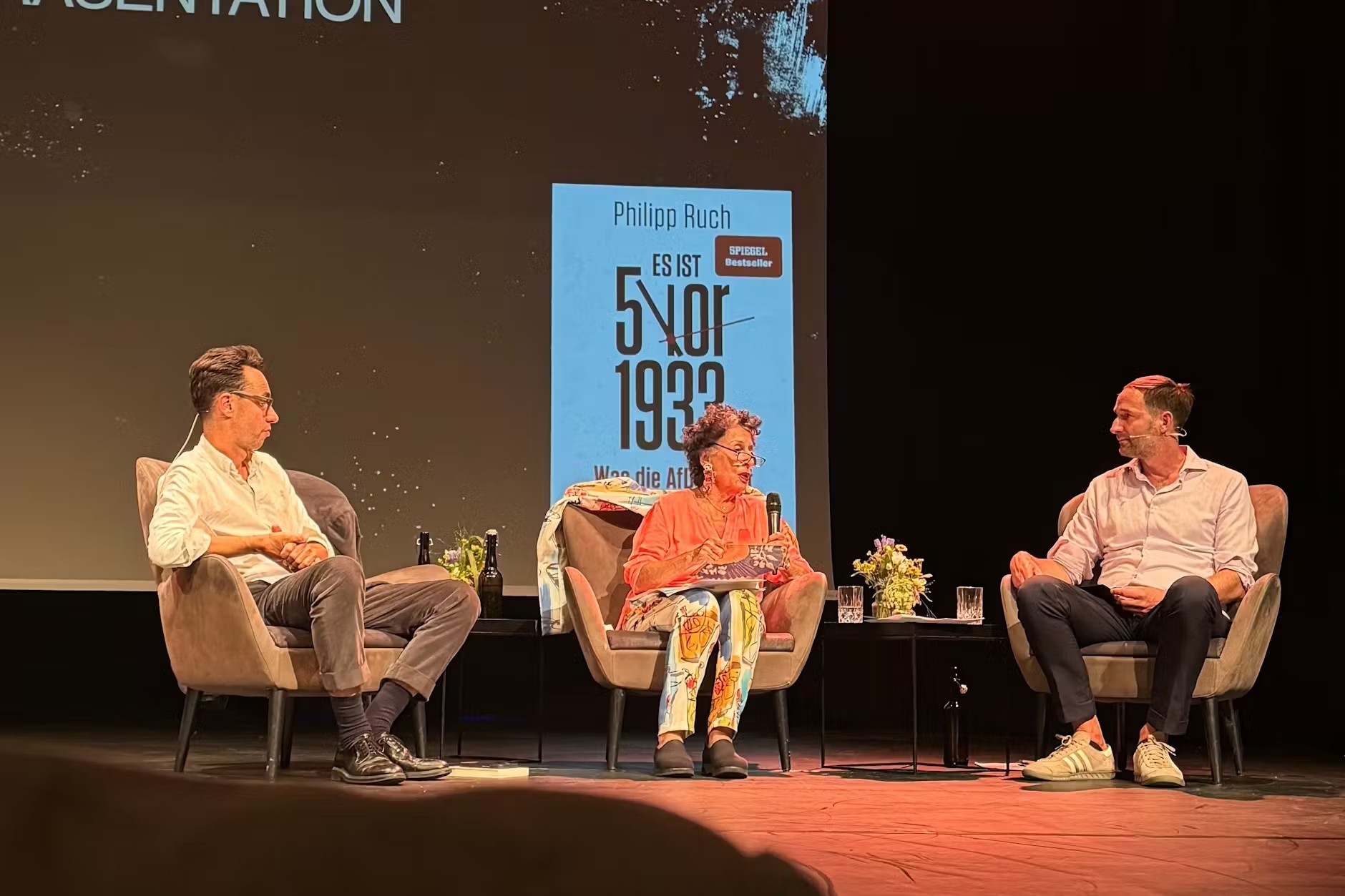Es heisst ja immer, dass alles mit allem zusammenhängt, die grossen und kleinen Dinge in der Welt, der Schmetterling und der Wirbelsturm, der Wirbelsturm und die Finanzkrise und alles mit dem Sack Reis in China. Wer dafür wirklich ein Gefühl bekommen will, muss mit Tadzio Müller sprechen. Bei ihm hängt Sex mit der Zerstörung unserer Umwelt genauso zusammen wie Wirtschaftspolitik mit der eigenen Psyche. Tadzio spricht schnell, er wechselt zwischen Englisch und Deutsch mehr als jeder Tiktoker und er sieht für seine 48 Jahre wirklich gut aus: glatte Haut, frische Augen, sportlich gekleidet.
Den Grund dafür sagt er gleich zu Beginn des Treffens in Kreuzberg: Er lebt seit 15 Monaten ohne chemische Drogen. Er habe aus der «Klimadepression» herausgefunden, sagt er und kann auch prominent auf sein eigenes Buch verweisen, dass diesen Weg zurück ins sein Leben als Aktivist ganz gut dokumentiert – schon im Buchtitel: «Zwischen Friedlicher Sabotage und Kollaps – Wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben». Es ist eine wütende Streitschrift, die versucht, ein aufgeklärtes Leben für all die zu skizzieren, die akzeptiert haben, dass der Kollaps der «Welt wie wir sie kennen» nicht mehr aufzuhalten ist. Zwischen den Zeilen ist es auch eine Beichte geworden.
Schon im Vorwort, auf den ersten Seiten des Buches, schreibt Tadzio Müller, seine «queere Sicht auf Politik», sei geprägt ist von seiner Erfahrung als «schwuler, HIV—, drogen- und sexpositiver Mann». Deshalb werde Scham eine grosse Rolle spielen in seinem Buch. All das ist keine Überraschung für alle, die zu seinen 12.000 Follower auf X gehören (@faggotsforfuture), seinen Newsletter «Friedliche Sabotage» abonniert haben, oder eines seiner durchaus radikalen Interviews im Spiegel gelesen hat, wo er von der «grünen RAF» erzählt. Tadzio Müller ist eine sehr laute, sehr gut informierte – und gleichzeitig die wohl ungewöhnlichste und sehr queere Stimme in der deutschen Klimadebatte.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der Sohn eines Wirtschaftsanwalts in der globalisierungskritischen Bewegung unterwegs. Er hat den Namen Tadzio, weil es eine Figur aus Thomas Manns Roman „Tod in Venedig“ ist. Nicht weil Thomas Mann schwule Weltliteratur geschrieben hat, sondern weil der Name nach Weltläufigkeit klingen sollte. Wegbegleiter sagen anerkennend über Müller, dass er schon immer so war: selbstbewusst, schlau und gut vernetzt in der Klima-Bewegung und zwischendurch auch in der Politik. Seit dem Jahr 2008 baut er als Kommunikationsberater die Klimabewegung in Deutschland auf – und arbeitet parallel für die linke Rosa-Luxemburg-Stiftung als Referent.
Er erinnert sich gern an vielen Proteste in den 2000ern, wie der gegen die Castor-Transporte im Wendland. «Wir haben es damals extra nicht Sabotage genannt», sagt er über diese Zeit, «aber wir haben den physischen Transport aufgehalten mit friedlichen Mitteln.» Er war damals der sichtbarste Pressesprecher, lebte bis 2006 noch ungeoutet mit einer Frau zusammen. Er sagt: «Ich bin jeden Abend neben einer Frau eingeschlafen, die ich geliebt habe, aber mit der ich kaum Sex hatte.» Er nennt es bewusst nicht Doppelleben, sein Schwulsein spielte erst später eine Rolle.
Als er sich dann 2007 nach Berlin zog und sich dort ins Leben stürzte, wurde es umso zentraler in seinem Leben. Er arbeitete viel und ging abends aus, hatte eine Beziehung, trennte sich, steckte sich 2010 mit dem HI-Virus an. «Ich hatte einen Liebhaber, von dem ich wusste, dass er positiv war.» Sie haben aufgepasst, weiss er noch, aber im Nachhinein ist er sich nicht sicher, ob er sich woanders angesteckt hat. «Die Schuld- und Schamfrage habe ich aber inzwischen längst überwunden.» Er nimmt seine Medikamente und ist froh, dass er kaum Nebenwirkungen hat.
Tadzio Müller gründet in Berlin mit die Anti-Kohle-Kampagne «Ende Gelände» und beteiligt sich später an den Demonstrationen im Hambacher Forst und Lützerath. Immer wieder zieht er viel Positives für sich aus diesem Gemeinschaftsgefühl, postet auf verschiedenen Plattformen auch begeistert Videos von den Versammlungen von der «Letzten Generation». Als langsam deutlich wird, dass immer mehr Deutsche deren Protest ablehnen, sie abfällig «Klimakleber» nennen, da merkt er, dass etwas zu Ende geht, auch für ihn.
In dieser Zeit im Jahr 2022 macht er drei Dinge, die er heute als Fehler bezeichnet. Eines ist ein unglücklicher Tweet nachdem ein LKW-Fahrer eine Radfahrerin überfahren hatte – lange war nicht klar, ob der Rettungswagen wegen eines Klimaprotests im Stau stand. Tadzio Müller schrieb nur: «Shit happens». Später entschuldigte er sich glaubwürdig, aber da war zum ersten Mal ein wirklich böser Zynismus zu erkennen.
Ein zweiter Fehler war das Interview im Spiegel, in dem er vor einer «grünen RAF» warnt. Er sagt darin voraus, dass ein kleiner Teil der Klimabewegung sich irgendwann radikalisieren werde. Er bezeichnet die Stör-Aktionen der Aktivisten als «Notwehr» und sagt: «Wenn die Repression gegen Notwehraktionen zu heftig ausfällt, werden einige in den Untergrund gehen.»
Er rudert in einem zweiten Interview ein Jahr später zurück, doch da hatten schon zu viele in so verstanden, dass er Gewalt gegen Menschen für wünschenswert erachte. Die «grüne RAF» wird ihn noch lange begleiten. Auch beim Gespräch im Frühling 2025 nennt er es einen «bewussten Provokationsversuch», der aber gescheitert sei. Die RAF rufe zu viel Panik beim Bürgertum hervor, sagt er, weil eben Menschen getötet wurden. Diese Dynamik habe er damals unterschätzt.
Der dritte Fehler ist vielleicht der gravierendste, weil es ihn noch länger verfolgen wird: Er beschliesst, seine Sexualität radikal offen zu leben, zum einen verbreitet er explizite Videos auf sozialen Netzwerken. Noch Jahre später werden diese Clips immer wieder von seinen Gegnern benutzt werden. Vor allem greifen diese Gegner dann auch auf eine Dokumentation des Y-Kollektivs zurück. Der Name des Films, der noch immer bei Youtube zu finden ist, lautet recht eindeutig «Chemsex – Warum einige Schwule auf Drogen Sex haben». In jenen fast 32 Minuten zeigt sich Tadzio Müller mehrfach nackt beim Drogenkonsum und in verschiedenen sexuellen Positionen.
Am Ende der Doku sitzt er angezogen im Park mit seinem Ex-Partner, er sieht fertig aus von mehreren wachen Nächten – aber er versucht weiterhin eine Lanze zu brechen für das offene, schamfreie Reden über Sex und Drogenkonsum. «Wenn wir hier von einer mit Alkohol durchsoffenen Nacht mit Sex reden würden, wäre es noch nicht einmal ein Thema», sagt er. «Drogen, weil sie so moralisch belegt sind, kann man ihnen unglaubliche Wirkungsmacht zuschreiben.»
Die Kommentare unter diesem wirklich offenherzigen Video reichen von mitleidig-besorgt über hämisch-lästernd bis zu dankbar-anerkennend. Manche Kommentare sind auch lustig: «Die Oma neben mir in der Bahn ist auch geflasht.» Kaum ein anderer Film des öffentlich-rechtlichen Netzwerks Funk wurde so kontrovers diskutiert wie dieser. Er ist auf den ARD-Seiten nicht mehr zu finden. Der Autor Nico Schmolke überlegt noch immer, einen zweiten, längeren Film zu drehen. Ob er noch einmal Tadzio Müller als Protagonisten nehmen würde, weiss er nicht.
Auch Tadzio Müller hat die Arbeit am Film als zwiespältig in Erinnerung. «Die Absprache war es», erinnert sich Tadzio, «einen vorurteilsfreien Film über Chemsex zu drehen.» Das Ziel war, die Scham aus dem Thema herauszuhalten. Den Film, den jetzt alle kennen, ist eine zweite Version, die erste Version sei laut Müller besser gewesen, weniger moralisierend. «Chemsex ist für mich wie freies Klettern am Felsen», sagt Tadzio, «es ist hochrisikohaftes Verhalten, aber jedes Gehirn reagiert anders auf Amphetamine und gerade ADHS-ler haben oft das Gefühl, unter Drogen eine Kontrolle über ihr Gehirn zu haben.» Er habe den Konsum lange kontrollieren können, mehr als zehn Jahre – bis er «keinen Grund mehr hatte, es zu kontrollieren.»
Ungefähr zu jener Zeit überfällt ihn die Depression, die – wie immer bei ihm – mit allem zu tun hat: Politik, Klimakollaps, Sex und seine gescheiterte grosse Liebe. Er schreibt das in seinen Newslettern und in Texten, die in Tageszeitungen erscheinen. Dort erzählt er in seiner typischen Sprache, wie die Klimakrise in immer auch persönlich betrifft. Für ihn ist die Katastrophe längst ein «Jetzt-Problem». Er schreibt, «dass es mit ziemlicher Sicherheit schon zu spät ist, den Kollaps des globalen Klimasystems verhindern; zu spät, um das Überschreiten der immer wieder erwähnten Kipppunkte zu verhindern. Kurz: Es ist zu spät, um uns zu retten. Sorry to burst your bubble.»
Wenn er heute auf diese Zeit kurz nach der Pandemie zurückblickt, ist ihm nicht mehr alles zugänglich. «Es gab Momente damals, da bin ich zu einer Fridays Demo gegangen oder irgendeine Blockade und habe mich danach so sinnlos und deprimierend angefühlt, dass ich nach Hause gekommen bin und erstmal weiter Drogen genommen habe.» In den tiefen Phasen seiner Depression wollte er sich selbst auch auslöschen, sagt er. «Ich hatte meine Zukunft schon verloren und konnte mir ein Leben über 2024 und 2025 hinaus nicht mehr vorstellen.» Das einzige, worin er damals einen Sinn sah: „Gib mir Tina, Tina, Tina und dann will ich mich unter irgendwelche random Typen legen.“ Tina ist der Spitzname für eine Droge, die eigentlich Meth-Amphetamin heisst oder: Crystal Meth.
Der Weg zurück für Tadzio Müller beginnt im Sommer 2022, als Malte C. getötet wird. Der 25-jährige Transmann bemerkt, wie Lesben auf dem CSD in Münster beleidigt werden. Als Malte den Täter zur Rede stellt, wird er selbst angegriffen und von dem erst 20 Jahre alten Angreifer, Deutscher Junior-Boxmeister, schliesslich so schwer verletzt, dass er fünf Tage später im Krankenhaus stirbt. Für Tadzio war das ein Wendepunkt.
«Ich weiss noch, ich kam selbst gerade aus einer durchfeierten Partynacht, als ich Anfang September vom Tod von Malte erfuhr.» Er sei in solchen Tagen besonders empfindlich, besonders «durchlässig». Tadzio Müller las in der Meldung einen Angriff auf einen der wenigen Safe Spaces, den Schwule und Lesben noch haben: den Christopher Street Day. «Der Tod von Malte hat mich irgendwie wachgerüttelt, hat mir einen Fluchtpunkt gegeben, auf den ich mein Leben wieder ausrichten konnte.» Es hat Tadzio Müller daran erinnert, dass es auch einen aktiven Weg heraus aus der Depression gibt: Wir müssen uns wieder verteidigen. «Egal, wie dunkel es ist, wir sind handlungsfähig.»
In seinem Buch beschreibt er auch, wie sich diese Selbstermächtigung auch auf die Klimabewegung übertragen lässt. Er führt dafür Schweden als Beispiel an, ein Land, dass sich nicht nur wegen der Nähe zu Russland, sondern auch wegen des rauen Klimas auf widrige Umstände vorbereiten muss. Seit einigen Jahren gibt es dort auch eine Bewegung «Preppa Tillsammans», die genau das zum Thema macht: Wie bereitet sich eine Gesellschaft auf den Klimawandel vor? Was tun, wenn der Strom ausfällt oder wenn Wirbelstürme Alltag werden? Der Zivilschutz steht im Zentrum.
Für Tadzio muss sich das auch auf Deutschland und auch auf die queere Community übertragen. «Das kann damit anfangen, dass wir lernen, Stich- oder Schusswunden zu verarzten», sagt Tadzio Müller, «aber Preppen bedeutet auch, sich auf den Fall vorzubereiten, wenn die HIV-Medikamente nicht mehr vom Staat übernommen werden.» Zum Teil werde dieser Zustand gerade schon vorbereitet in den vereinigten Staaten. «Ich kenne Menschen, die reden darüber Buyers Clubs zu gründen, also Kollektive, die HIV-Medikamente sammeln und sie an alle Mitglieder günstig weitergeben.»
Das gleiche gelte auch für trans Menschen, denen in den USA gerade der Zugang zu Hormonen oder zu Operationen deutlich erschwert wird. Die Welt verändert sich gerade sehr und einst sicher geglaubte Errungenschaften stehen plötzlich wieder in Zweifel. So eben auch die Sicherheit von Schwulen und Lesben auf einer Pride Parade in Europa.
Wenn Tadzio Müller von solchen Treffen mit Aktivisten erzählt, überschlägt sich wieder, aber nicht so rauschhaft wie in dem Chemsex-Video, sondern vor Begeisterung für die gegenseitige Hilfe, die Menschen bereit sind zu leisten. «Gerade unter HIV-Positiven ist manchmal eine Stimmung, die besonders Mut macht», sagt Müller, «denn sie haben eine wirkliche Erinnerung an Ihre Katastrophe vor 40 Jahren.» Sie seien alle Überlebende und das allein treibt sie aus der Lethargie. Tadzio nennt es «wirklich empowering.» Selbst wenn für ihn die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten ist, er will möglichst vorbereitet sein darauf.
Seit zweieinhalb Jahren ist das wieder sein Hauptjob, Sachen zu sagen, die Leute nicht hören wollen, oder wie er sagt: «erklären, was verrückte Menschen machen und warum.» Nichts anderes hat er beim Thema Chemsex getan, auch wenn das wohl vorerst scheiterte. Die Geschichten rund um diese Zeit will er hinter sich lassen, auch wenn sie ihm immer wieder vorgehalten werden. Wenn das passiert, kann er inzwischen nur mit den Schultern zucken. Ja, und? Gibt es nicht Wichtigeres zu besprechen, den Klimakollaps zum Beispiel? Die schmelzenden Polkappen? Die steigende Gewalt gegen queere Menschen? Es klingt nach: «I’ve moved on, you should, too.»
Am jenem Septemberabend im Jahr 2022, als er vom Tod von Malte C. in Münster erfährt, ist Tadzio Müller genau so müde und «durchlässig» wie er war zum Berliner Alexanderplatz gefahren. Dort trafen sich rund 20 Menschen zu einer Mahnwache. „Das waren wenig Leute, aber es war für mich der Anfang von etwas.“ Die Hoffnung, das merkte er in dem Augenblick, komme nämlich nicht allein von der Aussicht auf Erfolg, sondern aus den Beziehungen mit Menschen. «Und die entstehen, wenn wir versuchen, die Zukunft besser zu machen.»
Er dachte plötzlich darüber nach, sich zu wehren. Wie wäre es mit einem pink-silber gekleidetem Kampfkollektiv gegen rechte Schläger? Und statt Waffen haben sie Riesen–Dildos in den Händen? „Bad Ass“ eben. Er will die Idee noch einmal überdenken. Aber nichts tun – ist keine Option mehr.